Irina Gewinner1, Freya Gassmann2
1University of Luxembourg; 2Universität des Saarlandes
Die Herstellung von Chancengleichheit für Männer und Frauen wird von der Politik als erstrebenswertes Ziel aufgefasst (z. B. BMBF 2001). Nichtsdestotrotz liegt der Anteil der Professorinnen deutlich unter dem der Männer (Eurostat 2016). Generell ist bekannt, dass die unterschiedliche Zeitverwendung durch die Betreuung von Verwandten und Kindern oder im Haushalt ein Grund für den geringeren Anteil von Frauen in Führungspositionen sein kann (z.B. Klammer et al. 2011; Schürmann & Sembritzki 2017).
Dieser Beitrag analysiert, wie die wissenschaftlichen Beschäftigten ihre partnerschaftlichen bzw. familiären sozialen Rollen wahrnehmen und realisieren, welchen Effekt dies auf ihr generatives Verhalten hat und zur Unterrepräsentanz von Frauen in der Wissenschaft beiträgt. Besonderer Wert wird dabei auf die Bedeutung der kulturellen Dimension der innerfamiliären Arbeitsteilung sowie dem geschlechtsspezifischen Rollenverständnis gelegt.
Im Rahmen einer Triangulation werden für diese Studie empirische Forschungsergebnisse aus zwei Studien, die mittels verschiedener Methoden Daten erhoben haben, berichtet und gegenübergestellt. Konkret werden die Befunde aus einer empirischen Fragebogenerhebung sowie qualitativen Interviews, die beide u.a. Daten zur Familienplanung sowie Realisierung von Kinderbetreuung bei wissenschaftlichen Mitarbeiter/innen zum Ziel hatten, verglichen.
Insgesamt zeigt das vorhandene Datenmaterial, dass unter hochqualifizierten Personen ein klassisches Familienmodell praktiziert wird. Während sich quantitativ kein Unterschied im Stellenumfang zwischen Männern und Frauen ohne Kinder feststellen lässt, arbeiten Frauen mit Kindern signifikant weniger als ihre Kollegen insgesamt und ihre Kolleginnen ohne Kinder. Ebenso variiert der Beschäftigungsumfang zwischen Männern und Frauen entsprechend des Kinderbetreuungsanteils. Bisherige Forschung führt die Geschlechterungleichheit auf bloßes Vorhandensein der Kinder zurück, dieser Beitrag dagegen argumentiert, dass die kulturell bedingte Selbstverständlichkeit eines konservativen Geschlechterrollenmodells eine entscheidende Rolle spielt, sodass sich wissenschaftliche Mitarbeiter/innen an verbreitete soziale Normen und Leitbilder anpassen. Dies wird u.a. durch die Betonung der Sicherheit als Synonym für Reife und Erreichung eines Standardarbeitsverhältnisses sowie in der Idealisierung der Mutterrolle deutlich.
Video
Themenbereiche
- Offenes Thema
Autoren
Downloads
- Für diesen Beitrag sind keine zusätzlichen Anhänge verfügbar
Slot
- T1 Vorträge 1 (10∶15 11∶30)
Teilen Sie diesen Beitrag
![]()
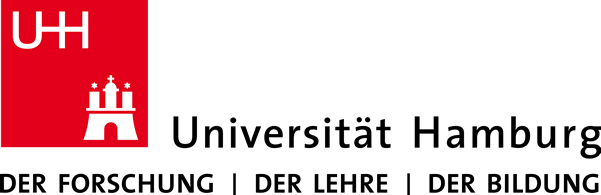

Vielen Dank für den interessanten Vortrag. Sicherlich ist es ein geselllschaftlich sehr relevantes und nicht unerhebliches Thema. Ich hätte eine Nachfrage: haben Sie auch Eltern interviewt, die trotz eines befristeten Arbeitsverhältnis sich für ein Kind entschieden haben und deren Abwägungen erfragt?
Liebe Frau Groß, danke für die Frage!
Ja, in den Interviews hatte ich 11 Frauen und zwei Männer, die Kinder hatten. Die meisten Personen sind Bildungsaufsteiger, d.h. kommen aus nicht-Akademikerfamilien, aus gutbürgerlichen Haushalten. Viele von denen haben eine Sozialisation gehabt, die von traditionellen Familienrollen geprägt ist. Das bedeutet, dass für sie Kinder ein wichtiger Bestandteil der Familie/des Lebens sind, sodass ein befristetes Arbeitsverhältnis keine bzw. weniger eine Hürde auf dem Weg zu Elternschaft darstellt. Ich fand es faszinierend, dass gerade die meisten Mütter aus dem Sample alternative Rollenmodelle gelebt haben, und schade, dass dies nicht zum Vorbild an den Universitäten wird. Ihre Praktiken der Elternschaft werden eher unter den Teppich gekehrt und nicht positiv thematisiert.
In meinem Paper ‚Work-life balance for native and migrant scholars in German academia: Meanings and practices‘ habe ich mehr darüber geschrieben, falls Sie zu diesem Thema etwas mehr lesen möchten.
Ich möchte mich auch für den Vortrag bedanken. Spannend finde ich die alternativen Modelle bei den Frauen mit Kindern im qualitativen Teil ihrer Studie. Allerdings widerspricht dieses den Ergebnissen der quantitiativen Studie, nach der Frauen mit Kindern ihren Beschäftigungsumfang reduzieren. Dieses Muster – Väter erhöhen Beschäftigungsumfang, Mütter reduzieren Beschäftigungsumfang – haben wir auch bei einer Auswertung der Befragung „Balancierung von Wissenschaft und Elternschaft“ (2008) gefunden. Ein Hinweis noch auf die Verknüpfung von Verteilung der Sorgearbeit und der Unterrepräsentanz von Frauen in Führungspositionen der Wissenschaft: Dabei ist zu bedenken, dass 70% der wiss. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter keine Kinder haben. Die Verbindung zwischen Sorgearbeit und Unterrepräsentanz ist also komplizierter, wobei der interessante Hinweis auf die Idealisierung der Elternrolle und das Bild der „perfekten Mutter“ vielleicht Hinweise für die Verbindung geben.
Liebe Frau Löther, herzlichen Dank für Ihr Interesse an unserer Arbeit und die Überlegungen bezüglich der Ergebnisse!
Zu Ihrer 1. Frage: Die Tatsache, dass die alternativen Modelle der Sorgearbeit nur im qualitativen Teil der Arbeit zum Vorschein kommen, kann ein Selektionseffekt sein. Die qualitativen Interviews wurden bundesweit geführt und haben somit ein breiteres Publikum umfasst. Auf diese Modelle, die immer noch nicht sehr weit verbreitet sind, und deren Hintergründe gehe ich in einem anderen Paper ein (es heißt ‚Work-life balance for native and migrant scholars in German academia: Meanings and practices‘).
Zu Ihrer 2. Frage: Sie haben recht, man kann die Unterrepräsentanz nicht nur auf die Sorgearbeit zurückführen, weil 70% der wiss. MA keine Kinder haben und somit keine Sorgearbeit leisten. Wir zeigen, warum diese Personen keine Kinder haben und dass es gegenüber Elternschaft viele Stereotype gibt. Evtl. ist es auch die gesellschaftliche Erwartung, dass frischgebackene Mütter aus der Wissenschaft aussteigen, und werden dann weniger befördert.
Vielen Dank für Ihre Präsentation! Ihre Ergebnisse spiegeln die Beobachtungen wider und sind daher sehr gut nachvollziehbar. Ich denke, dass ein Blick in andere Berufsfelder eher noch größere Unterschiede bezüglich des Beschäftigungsumfangs beider Geschlechter aufzeigt.
Was jedoch spannend wäre: Lassen sich Unterschiede zwischen Frauen in befristeten oder unbefristeten Anstellung bezüglich Familiengründung bzw. Beschäftigungsumfang aus der Telefonbefragung erkennen?
Herzlichen Dank für die Rückmeldung und Ihre Hinweise!
Das Problem zur Untersuchung der Auswirkungen von Befristung auf die Familiengründung bzw. Beschäftigungsumfang ist, dass die Anzahl der Personen mit unbefristeten Stellen gering ist. Soweit ich weiß, gab es unter den Personen, mit denen ein qualitatives Interview geführt wurde keine Personen mit einer Dauerstelle. Im quantitativen Datensatz sind es rund 20%. Im bivariaten Vergleich zeigt sich, dass die unbefristete Stelle sign. positiv mit dem Haben von Kindern zusammenhängt. Dieser Effekt verschwindet jedoch nach Kontrolle des Alters. Nach einer Betrachtung der Interaktion zu unterschiedlichen Alterspunkten deutet sich an, dass unbefristete Beschäftigte etwas früher Kinder bekommen. Geschlechtsdifferenzen zeigen sich hier, bis auf den Effekt, dass Männer generell etwas später Kinder bekommen nicht. Jedoch sind die Ergebnisse auf Grundlage dieses Datensatzes und den geringen Anteilen von unbefristeten Beschäftigten und Personen mit Kindern nicht verlässlich.
Es zeigt sich jedoch in den Einstellungsfragen oder den Begründungen, warum der vorhandene Kinderwunsch noch nicht realisiert wurde, dass die Befristung der Verträge ein zentraler Grund ist.